Ein Aufzug macht ein Mietobjekt attraktiver – verursacht aber auch laufende Kosten. Als Vermieter:in stehst du vor der Herausforderung, diese Aufzugskosten korrekt in der Nebenkostenabrechnung zu berücksichtigen. Doch welche Kostenarten sind umlagefähig? Wie erfolgt die Verteilung auf die einzelnen Mieter:innen? Und welche Investitionen musst du selbst tragen?
In diesem Ratgeber erfährst du, wie du Aufzugskosten rechtssicher abrechnest, typische Fehler vermeidest und welche Nebenkosten du auf deine Mieter:innen umlegen kannst.
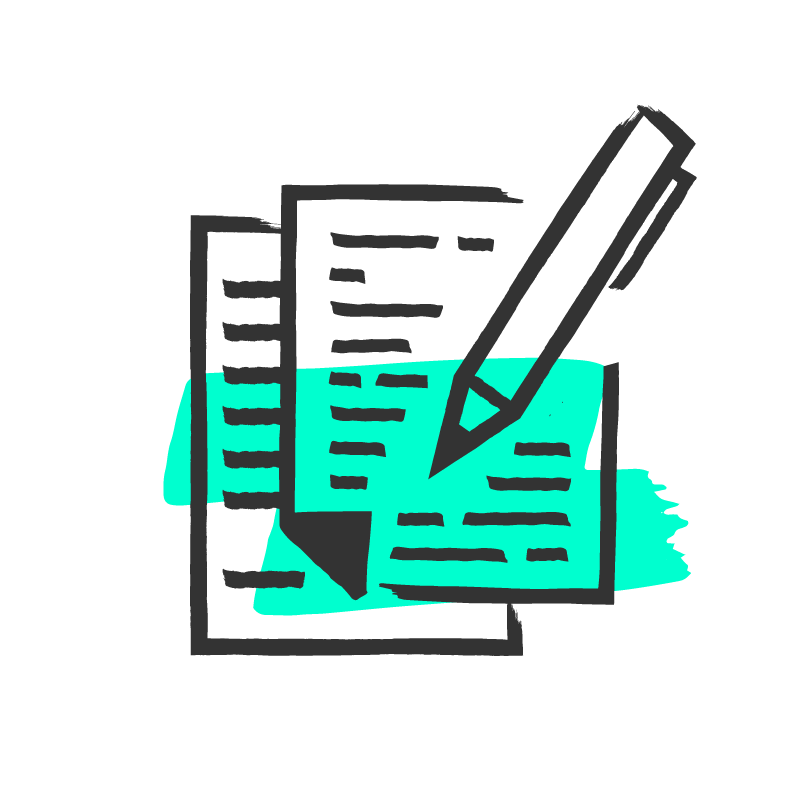
Es ist Zeit für deine Betriebskostenabrechnung?
In nur wenigen Schritten erstellst du deine rechtssichere Betriebskostenabrechnung mit VermietenPlus. Im Anschluss kannst du diese einfach herunterladen oder sie direkt an deine Mieter:innen schicken.

Aufzugskosten wie Wartung, Betriebsstrom, Reinigung und Notrufbereitschaft dürfen als Nebenkosten auf Mieter:innen umgelegt werden.
Reparaturen und Modernisierungskosten des Aufzugs sind nicht umlagefähig und müssen von Vermieter:innen selbst getragen werden.
Auch Mieter:innen im Erdgeschoss können an den Aufzug-Nebenkosten beteiligt werden, wenn der Mietvertrag eine entsprechende Umlageklausel enthält.
Vermieter:innen können die Nebenkostenabrechnung ganz einfach mit VermietenPlus von ImmoScout24 erstellen.
- Was sind Aufzugskosten und welche Arten gibt es?
- Was kostet ein Aufzug?
- Kosten für einen Aufzug – Einbau in ein Bestandsgebäude
- Beispiel: Was kostet ein Aufzug für 4 Stockwerke?
- Typische Wartungskosten pro Jahr
- Können Aufzugskosten auf Mieter:innen umgelegt werden?
- Wie werden Aufzugskosten verteilt?
- Nachträglicher Einbau eines Aufzugs: Möglichkeiten und Kosten
- Pflichten von Vermietern beim Betrieb eines Personenaufzugs
- Fazit: Aufzugskosten clever verwalten und korrekt abrechnen
- FAQ: Häufige Fragen zu Aufzugskosten
Ein Aufzug ist nicht nur ein Komfortmerkmal für viele Mieter:innen – er ist auch eine technische Anlage, die Kosten verursacht. Als Vermieter:in solltest du genau wissen, welche Arten von Aufzugskosten es gibt und welche davon du über die Nebenkosten abrechnen darfst.

Zu den laufenden Betriebskosten eines Aufzugs gehören verschiedene Posten, die regelmäßig anfallen. Dazu zählen etwa:
- die Wartung und Sicherheitsüberprüfung durch Fachfirmen,
- der Betriebsstrom, der für den Fahrstuhl benötigt wird,
- die Reinigung der Aufzugskabine und der Schachtbereiche,
- die Notrufbereitschaft und Überwachungseinrichtungen.

Viele Vermieter:innen schließen Wartungsverträge ab, um eine konstante Überprüfung und Wartung sicherzustellen. Diese Kosten sind – richtig aufgeschlüsselt – umlagefähig und gehören zur Nebenkostenabrechnung.
Je nach Nutzungshäufigkeit und Gebäudetyp können diese Kosten stark variieren. In einem Haus mit vielen Parteien oder mit gewerblichen Einheiten im Erdgeschoss fallen in der Regel höhere Betriebskosten an als in einem kleinen Wohnhaus mit wenigen Mietparteien.
Neben den regelmäßigen Betriebskosten entstehen manchmal hohe Investitionskosten: beim Einbau eines neuen Aufzugs oder der Modernisierung einer bestehenden Anlage.
Diese einmaligen Kosten dürfen nicht auf die Mieter:innen umgelegt werden. Sie gelten als Investitionen in die Substanz der Immobilie und müssen vom Eigentümer bzw. der Eigentümerin getragen werden.
Hinweis:
Bei Modernisierungen kann unter Umständen eine Mieterhöhung nach
§ 559 BGB möglich sein – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit rechtzeitiger Ankündigung.
Ein Aufzug ist heute mehr als ein reiner Komfortfaktor: Er trägt maßgeblich zur besseren Vermietbarkeit deiner Immobilie bei.
- Wohnungen in oberen Etagen lassen sich deutlich leichter vermieten, wenn sie bequem per Fahrstuhl erreichbar sind.
- Ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern und Menschen mit körperlichen Einschränkungen sind auf barrierearme Zugänge angewiesen – ein Aufzug eröffnet dir also eine größere Zielgruppe.
- Schwere Einkäufe, Kinderwagen oder Möbeltransporte werden durch einen Aufzug spürbar erleichtert.
- Immobilien mit Aufzug können häufig eine höhere Miete verlangen und bieten geringere Leerstandsrisiken.

Ein Aufzug ist nicht nur ein Kostenfaktor – richtig eingesetzt, kann er den Marktwert und die Attraktivität deiner Immobilie nachhaltig steigern.
Als Vermieter:in ist es wichtig zu wissen, welche Kosten ein Aufzug verursachen kann – nicht nur bei der Anschaffung, sondern vor allem in Bezug auf die laufenden Nebenkosten, die später auf die Mieter:innen umgelegt werden dürfen.
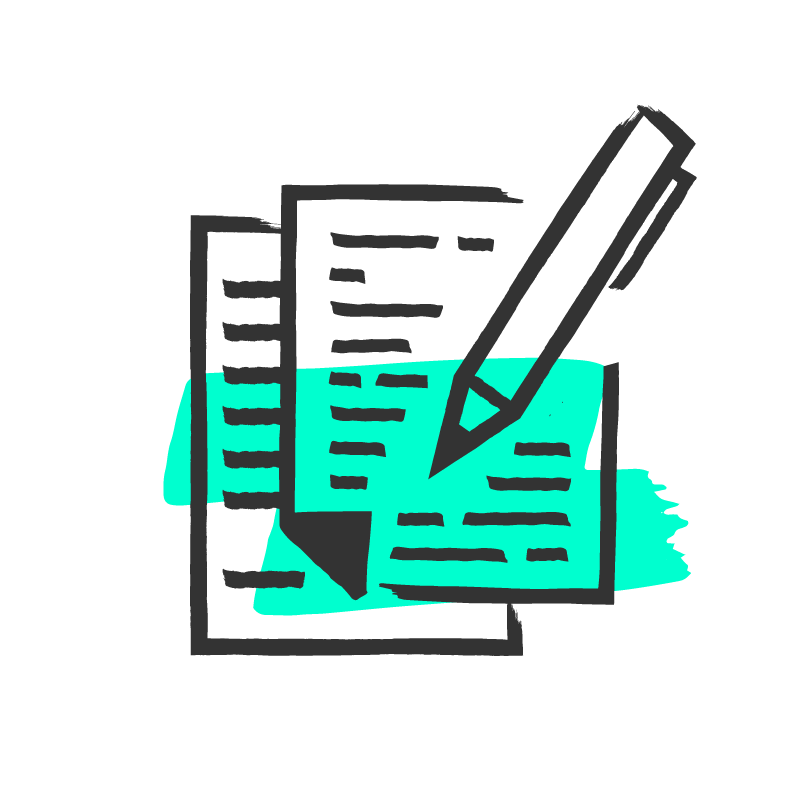
Es ist Zeit für deine Betriebskostenabrechnung?
In nur wenigen Schritten erstellst du deine rechtssichere Betriebskostenabrechnung mit VermietenPlus. Im Anschluss kannst du diese einfach herunterladen oder sie direkt an deine Mieter:innen schicken.
Ein nachträglicher Einbau eines Aufzugs in ein bestehendes Gebäude ist technisch in vielen Fällen möglich – allerdings auch mit erheblichen Investitionen verbunden. Die Gesamtkosten für den Einbau eines Aufzugs liegen je nach Gebäudeart, Technik und baulichen Voraussetzungen zwischen 40.000 und 120.000 Euro.
Dabei entstehen Kosten für:
- den eigentlichen Aufzug (Mechanik, Kabine, Steuerung),
- die bauliche Anpassung des Gebäudes (Schachtbau, Fundament, Stromanschluss),
- Architekten- und Planungsleistungen,
- Genehmigungen und TÜV-Abnahmen.
Auch bei einem Aufzug in einem Einfamilienhaus musst du je nach Bauweise und Technik mit Kosten zwischen etwa 20.000 und 80.000 Euro rechnen.
Hinweis für Vermieter:innen:
Die reinen Einbaukosten gelten als Investitionskosten und sind nicht umlagefähig. Du kannst diese Ausgaben also nicht über die Nebenkostenabrechnung auf deine Mieter:innen umlegen.
Ein konkretes Beispiel:
Für ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus kannst du mit folgenden Einbaukosten rechnen:
- Hydraulikaufzug: etwa 50.000 bis 80.000 Euro
- Seilaufzug: etwa 70.000 bis 100.000 Euro
Zusätzlich können noch 10.000 bis 20.000 Euro für bauliche Anpassungen dazukommen.

Wenn du als Vermieter:in den nachträglichen Einbau eines Aufzugs planst, solltest du auch die späteren Nebenkosten für Wartung, Stromverbrauch und Instandhaltung frühzeitig kalkulieren. Diese laufenden Kosten sind grundsätzlich auf die Mieter:innen umlegbar und sollten bei der Mietkalkulation berücksichtigt werden.
Neben den Einmalkosten für Einbau oder Modernisierung entstehen laufende Wartungskosten, die über die Nebenkosten abgerechnet werden dürfen.
Im Durchschnitt solltest du folgende jährliche Wartungskosten für einen Aufzug einplanen:
| Aufzugsart | Wartungskosten pro Jahr |
|---|---|
| Hydraulikaufzug | ca. 500 – 1.000 € |
| Seilaufzug | ca. 700 – 1.500 € |
| Plattformlift | ca. 300 – 700 € |

Die genannten Preise beziehen sich auf die reine Anschaffung des Aufzugs bei Neubauten oder bei Gebäuden, die bereits für einen Aufzug vorbereitet sind.
Beim nachträglichen Einbau in Bestandsbauten musst du zusätzlich mit erheblichen Baukosten für Schachtbau, Fundamentarbeiten und Gebäudeverstärkungen rechnen. Diese Zusatzkosten können je nach Gebäudezustand 30 bis 50 Prozent der reinen Anschaffungskosten betragen.

Denke bei der Auswahl eines Aufzugs nicht nur an die Anschaffungskosten, sondern auch an die langfristigen Nebenkosten für Betrieb, Wartung und mögliche Reparaturen.
Die Wartungskosten variieren je nach Alter des Aufzugs, Nutzungsfrequenz und Wartungsvertrag. Um spätere Diskussionen mit Mieter:innen zu vermeiden, solltest du sicherstellen, dass diese Wartungskosten realistisch und marktüblich sind.
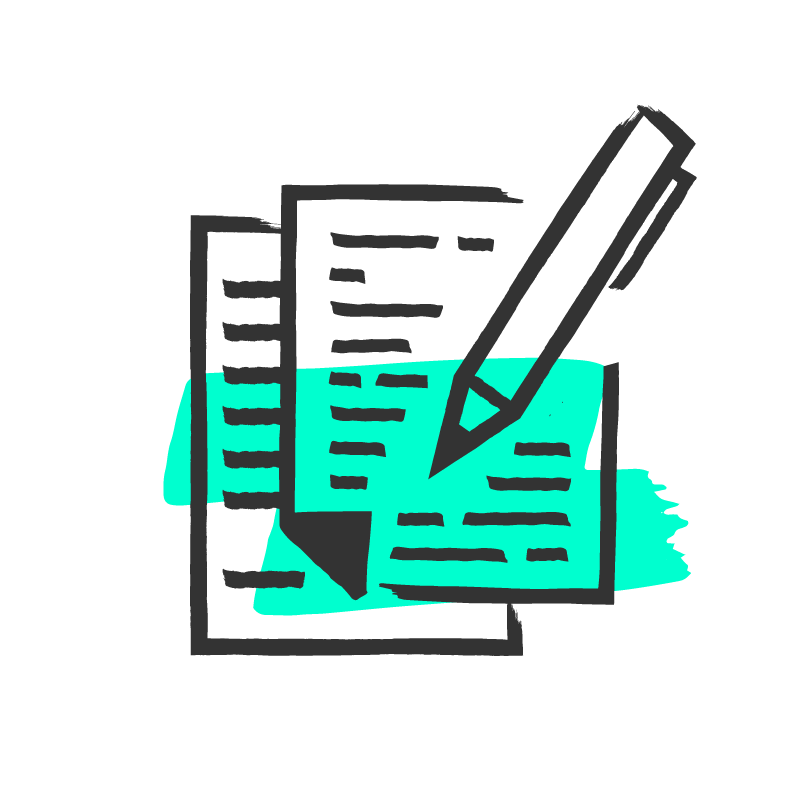
Es ist Zeit für deine Betriebskostenabrechnung?
In nur wenigen Schritten erstellst du deine rechtssichere Betriebskostenabrechnung mit VermietenPlus. Im Anschluss kannst du diese einfach herunterladen oder sie direkt an deine Mieter:innen schicken.
Als Vermieter:in hast du grundsätzlich die Möglichkeit, bestimmte Aufzugskosten im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf deine Mieter:innen umzulegen. Allerdings ist genau geregelt, welche Kostenarten umlagefähig sind – und welche du selbst tragen musst.
Die Grundlage bildet § 2 Nr. 7 der Betriebskostenverordnung (BetrKV).
Umlagefähig Nebenkosten sind die laufenden Betriebskosten, die für den Betrieb, die Wartung und die Überwachung des Aufzugs anfallen. Dazu gehören:
- Kosten für Wartung und regelmäßige Sicherheitsprüfungen:
Fachfirmen übernehmen die regelmäßige Inspektion und Instandhaltung der Aufzugsanlage. - Kosten für Betriebsstrom:
Der Stromverbrauch des Aufzugs gehört zu den umlagefähigen Nebenkosten. - Kosten für Reinigung des Aufzugs und der Schachtbereiche:
Reinigungseinsätze für Kabine und Technikräume sind umlagefähig. - Kosten für Überwachung und Notrufbereitschaft:
Dazu zählen insbesondere die Gebühren für Notrufsysteme und 24h-Bereitschaftsdienste.

Führe diese Positionen möglichst klar und einzeln auf. Das erhöht die Transparenz und beugt späteren Rückfragen oder Streitigkeiten mit Mieter:innen vor.
Nicht alle Aufzugskosten dürfen auf die Mieter:innen umgelegt werden.
Typische Beispiele für nicht umlagefähige Betriebskosten sind:
- Reparaturen:
Defekte oder Schäden am Aufzug dürfen nicht über die Nebenkosten abgerechnet werden. - Instandhaltung und Modernisierung:
Erneuerung wesentlicher Bauteile oder der Austausch ganzer Anlagenteile (z. B. neuer Antrieb) gelten als Investitionen und sind vom Vermieter oder der Vermieterin selbst zu tragen. - Erstinstallation eines Aufzugs:
Kosten für den Einbau eines Aufzugs können nicht auf die Mieter:innen umgelegt werden.
Wichtig:
Nur die tatsächlichen Kosten für den laufenden Betrieb dürfen Bestandteil der Nebenkostenabrechnung sein.
Eine transparente und saubere Trennung dieser Kosten ist Pflicht.
Viele Vermieter:innen entscheiden sich für einen sogenannten Vollwartungsvertrag mit einer Aufzugsfirma.
Diese Verträge umfassen nicht nur die klassische Wartung, sondern auch Instandhaltungs- und kleinere Reparaturleistungen.
Achtung:
Nur der Teil des Vertrags, der echte Wartungs- und Überwachungsleistungen betrifft, ist umlagefähig.
Reparaturleistungen oder Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht auf die Mieter:innen umgelegt werden.

Achte darauf, dass der Vollwartungsvertrag die Kostenanteile klar aufschlüsselt. Im Zweifel kannst du bei der Nebenkostenabrechnung eine nachvollziehbare Trennung dokumentieren, um Ärger mit Mieter:innen zu vermeiden.
Immer wieder stellen Vermieter:innen die Frage, ob einmalige Notfalleinsätze –, etwa wenn ein:e Mieter:in im Aufzug steckenbleibt – über die Nebenkosten abgerechnet werden dürfen.
Die Antwort lautet: Ja, aber unter Bedingungen.
- Regelmäßige Notrufbereitschaft (24/7-Service) ist umlagefähig.
- Einzelne Notfallbefreiungen (z. B. Einsatz einer Servicefirma) dürfen ebenfalls umgelegt werden, sofern sie angemessen und belegbar sind.
Hinweis:
Behalte die Kostenentwicklung im Blick. Häufen sich Notrufe aufgrund technischer Mängel, könnte eine tiefere Instandsetzung notwendig sein – diese Kosten sind dann nicht umlagefähig.
Ein gut verhandelter Wartungsvertrag spart dir als Vermieter:in auf lange Sicht Kosten und Ärger.
Darauf solltest du achten:
- Pauschale vs. Einzelabrechnung:
Bei einer Pauschale hast du Planungssicherheit, bezahlst aber im Schnitt etwas mehr.
Bei Einzelabrechnung zahlst du nur bei tatsächlichen Einsätzen – kannst aber im Schadensfall teure Überraschungen erleben. - Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen:
Achte auf flexible Laufzeiten und eine kurze Kündigungsfrist, falls sich der Dienstleister ändert oder Kosten explodieren. - Klare Kostentrennung:
Der Vertrag sollte klar zwischen Wartung (umlagefähig) und Reparatur/Instandhaltung (nicht umlagefähig) unterscheiden.

Vergleiche regelmäßig Angebote und hole Alternativen ein. So stellst du sicher, dass du marktgerechte Preise zahlst – und deine Nebenkostenabrechnung jederzeit rechtssicher bleibt.
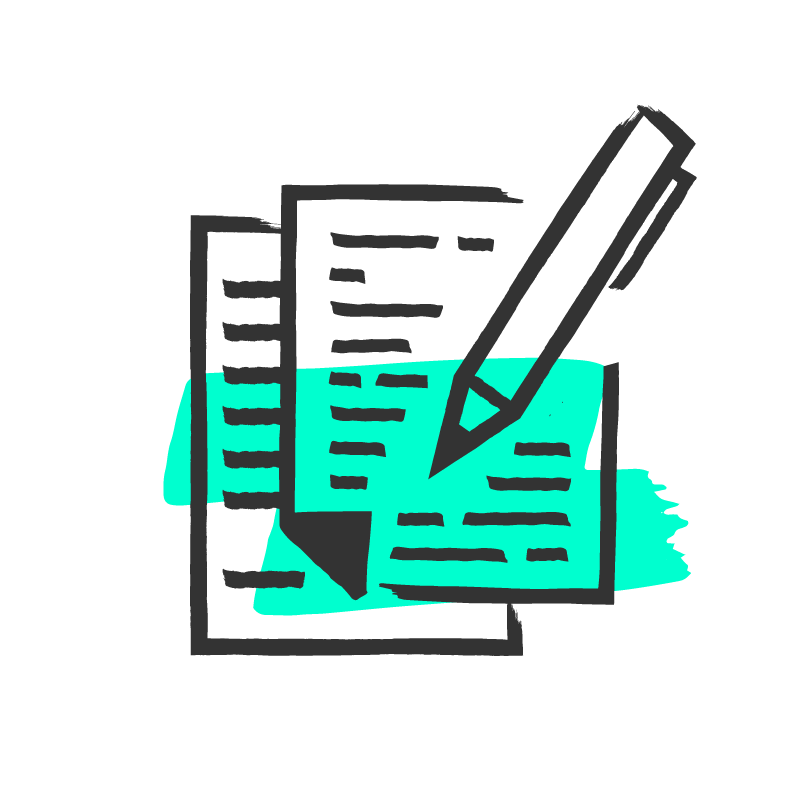
Es ist Zeit für deine Betriebskostenabrechnung?
In nur wenigen Schritten erstellst du deine rechtssichere Betriebskostenabrechnung mit VermietenPlus. Im Anschluss kannst du diese einfach herunterladen oder sie direkt an deine Mieter:innen schicken.
Nicht nur die Höhe der Aufzugskosten ist entscheidend – auch die gerechte Verteilung auf die einzelnen Mieter:innen spielt eine zentrale Rolle. Als Vermieter:in musst du sicherstellen, dass die Kosten korrekt umgelegt werden und die Nebenkostenabrechnung nachvollziehbar bleibt.
Die Aufzugskosten werden in der Regel entsprechend dem im Mietvertrag vereinbarten Verteilerschlüssel auf die Mieter:innen aufgeteilt.
Üblich sind folgende Varianten:
- Verteilung nach Wohnfläche:
Am häufigsten werden die Nebenkosten für den Aufzug anteilig nach der jeweiligen Wohnfläche der Mietpartei berechnet.
Beispiel: Eine 100 m²-Wohnung zahlt mehr als eine 60 m²-Wohnung. - Verteilung nach Nutzeranzahl:
Seltener, aber ebenfalls möglich: Die Umlage erfolgt nach der Anzahl der Personen, die in der jeweiligen Wohnung leben.
Wichtig:
Der Umlageschlüssel für Aufzugskosten richtet sich in der Regel nach der Wohnfläche der einzelnen Mietparteien, sofern im Mietvertrag nichts anderes vereinbart ist.
Eine spätere Änderung des Verteilerschlüssels ist nur mit Zustimmung aller Mieter:innen möglich.

Prüfe bei Neuabschlüssen von Mietverträgen genau, welcher Verteilerschlüssel sinnvoll ist – und dokumentiere ihn eindeutig im Vertrag.
Ein häufiger Streitpunkt ist die Umlage der Aufzugskosten auf Mieter:innen, die im Erdgeschoss wohnen oder den Aufzug kaum oder gar nicht nutzen.
Hier gilt:
- Auch Mieter:innen im Erdgeschoss oder ersten Obergeschoss können an den Aufzugskosten beteiligt werden – unabhängig davon, ob sie den Aufzug tatsächlich nutzen.
- Das gilt selbst dann, wenn sie erklären, stets die Treppe zu benutzen.
Ausnahme:
Nur wenn ein Gebäudeteil keinen Zugang zum Aufzug hat (z. B. ein separater Flügel ohne Aufzugsverbindung), dürfen die Mieter:innen dort nicht anteilig belastet werden.

Ein Haus hat zwei Eingänge, aber nur einen Aufzug, der den einen Gebäudeteil bedient. Mieter:innen im nicht erschlossenen Teil müssen keine Nebenkosten für den Aufzug zahlen.
In einem gemischt genutzten Gebäude – etwa mit Arztpraxen, Kanzleien oder Büros – kann der Aufzug durch den erhöhten Publikumsverkehr besonders stark beansprucht werden.
Das führt oft zu höheren Betriebskosten.
Wie musst du als Vermieter:in damit umgehen?
- Vorwegabzug:
In solchen Fällen solltest du vor der allgemeinen Umlage einen Vorwegabzug vornehmen.
Das heißt: Das Gewerbe übernimmt einen angemessenen Anteil der höheren Aufzugskosten, bevor der Rest auf die Wohnungsmieter:innen verteilt wird. - Keine Pflicht zur Offenlegung:
Du bist rechtlich nicht verpflichtet, den Vorwegabzug in der Nebenkostenabrechnung explizit darzustellen. - Was passiert bei Fragen von Mieter:innen?
Verlangen Mieter:innen Auskunft über einen möglichen Vorwegabzug, solltest du ihnen transparent mitteilen, ob und wie du den höheren Verbrauch des Gewerbes berücksichtigt hast.

Die Beweislast für erhebliche gewerbliche Mehrkosten liegt bei den Mieter:innen. Können sie glaubhaft machen, dass der Gewerbeanteil deutlich höhere Kosten verursacht, kann ein höherer Vorwegabzug verlangt werden.

Um spätere Diskussionen zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Vorwegabzug schon bei der Mietvertragsgestaltung zu bedenken und klar zu regeln.
Die Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 20.09.2006 (Az.: VIII ZR 103/06) bringt Klarheit:
- Auch Mieter:innen im Erdgeschoss können zur Zahlung von Aufzugskosten verpflichtet werden.
- Eine tatsächliche Nutzung des Aufzugs ist für die Umlage nicht erforderlich.
- Maßgeblich ist allein, dass der Aufzug zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung steht.
Bedeutung für die Praxis:
Du darfst als Vermieter:in also grundsätzlich alle Mieter:innen an den Aufzug-Nebenkosten beteiligen – solange der Mietvertrag eine entsprechende Umlageklausel enthält und keine baulichen Besonderheiten (z. B. fehlender Zugang) vorliegen.
Hinweis für Vermieter:innen:
Die Kosten für den Betrieb eines Aufzugs sind in § 2 Nr. 7 der Betriebskostenverordnung geregelt und damit umlagefähig.
Damit du die Aufzugskosten rechtssicher auf alle Mieter:innen – einschließlich Erdgeschossbewohner:innen – umlegen kannst, sollte der Mietvertrag entweder ausdrücklich die Aufzugskosten nennen oder allgemein auf die Betriebskosten gemäß § 2 BetrKV verweisen.
Eine zu allgemeine Formulierung („sonstige Betriebskosten“) reicht allein nicht aus.
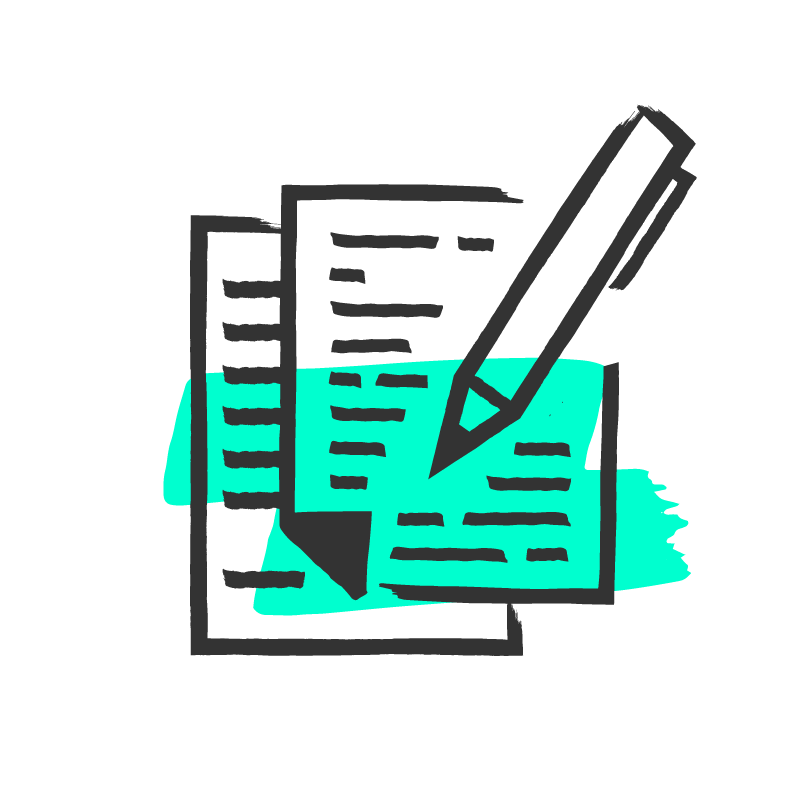
Es ist Zeit für deine Betriebskostenabrechnung?
In nur wenigen Schritten erstellst du deine rechtssichere Betriebskostenabrechnung mit VermietenPlus. Im Anschluss kannst du diese einfach herunterladen oder sie direkt an deine Mieter:innen schicken.
Ein Aufzug steigert nicht nur den Wohnkomfort, sondern kann den Wert eines Mietobjekts erheblich erhöhen. Gerade in älteren Bestandsgebäuden überlegen viele Vermieter:innen, einen Aufzug nachträglich einzubauen.
Doch wann ist ein nachträglicher Aufzugeinbau möglich – und welche Kosten kommen auf dich zu?
Grundsätzlich ist ein nachträglicher Einbau in vielen Gebäuden technisch machbar – allerdings hängt die Realisierbarkeit stark von der Bausubstanz und der Architektur ab.
Wichtige Voraussetzungen sind:
- ausreichend Platz für einen Aufzugsschacht, entweder innen oder außen am Gebäude,
- bauliche Tragfähigkeit der betroffenen Etagen und Fundamente,
- Erschließung der Etagen ohne große Eingriffe in die Bausubstanz,
- Genehmigungen durch Bauamt und ggf. Denkmalschutzbehörden.

Bei älteren Gebäuden kann es oft sinnvoller (und günstiger) sein, einen Außenaufzug zu installieren, da so weniger Eingriffe in die bestehende Gebäudestruktur nötig sind.

Für den Einbau eines Aufzugs benötigst du fast immer eine Baugenehmigung. Kläre die Genehmigungspflicht rechtzeitig mit den zuständigen Behörden.
Die Kosten für den nachträglichen Einbau hängen stark von den baulichen Gegebenheiten ab.
Grobe Richtwerte:
- Innenaufzug (mit Schacht im Gebäude):
etwa 50.000 bis 120.000 Euro – je nach Gebäudehöhe, Technik und Ausbaustandard. - Außenaufzug (an der Fassade):
etwa 60.000 bis 140.000 Euro, da zusätzliche Arbeiten für Witterungsschutz und Fundament notwendig sind.
Hinweis:
Diese Summen beziehen sich auf die reinen Investitionskosten für Planung, Lieferung und Montage des Aufzugs.
Hinzu kommen oft noch:
- Statikgutachten,
- Brandschutzmaßnahmen,
- Anschlussarbeiten für Strom und Steuerung,
- Folgekosten für Wartung und Betrieb.

Auch wenn die Einbaukosten hoch erscheinen: Ein Aufzug kann die Vermietbarkeit deutlich erhöhen und höhere Mieteinnahmen ermöglichen.
Die später entstehenden laufenden Betriebskosten (Wartung, Strom, Reinigung) dürfen als Nebenkosten auf die Mieter:innen umgelegt werden – Investitionskosten hingegen nicht.
Um die hohen Investitionskosten etwas abzufedern, kannst du verschiedene Förderprogramme in Anspruch nehmen.
KfW-Programme:
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet spezielle Förderprogramme für Maßnahmen zur Barrierereduzierung. Besonders relevant:
- KfW-Programm 455-B („Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss")
- Zuschuss bis zu 6.250 Euro pro Wohneinheit möglich (Stand 2024).
- Förderfähig sind auch Aufzugsanlagen, die den Zugang zu Wohnungen verbessern.
- KfW-Programm 159 („Altersgerecht Umbauen – Kredit")
- Zinsgünstiger Kredit bis 50.000 Euro pro Wohneinheit.
Wichtig:
Die Förderung muss vor Beginn der Bauarbeiten beantragt werden! Ein nachträglicher Antrag ist nicht möglich.

Informiere dich frühzeitig über die aktuellen Fördermöglichkeiten, da die Programme je nach politischer Haushaltslage jährlich angepasst werden.
Ein Aufzug im Mietshaus ist nicht nur ein Komfortmerkmal – er bringt für Vermieter:innen auch klare gesetzliche Pflichten mit sich.
Sorgfältige Wartung und funktionierende Sicherheitssysteme sind dabei essenziell, um Haftungsrisiken zu vermeiden und die Betriebskosten rechtssicher auf die Mieter:innen umzulegen.
Als Betreiber:in eines Aufzugs bist du gesetzlich verpflichtet, die Anlage regelmäßig prüfen und warten zu lassen.
Relevante Vorschriften sind u. a. die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 3121 und TRBS 1201).
Konkret bedeutet das:
- Wiederkehrende Hauptprüfungen:
Mindestens alle zwei Jahre muss eine umfassende sicherheitstechnische Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV, DEKRA) erfolgen. - Jährliche Zwischenprüfungen:
Einmal jährlich ist zusätzlich eine sicherheitstechnische Kontrolle erforderlich – meist durch eine Wartungsfirma. - Regelmäßige Wartungen:
Die Wartungsintervalle hängen vom Aufzugstyp und der Nutzung ab, liegen aber meist zwischen vier und sechs Wartungen pro Jahr.
Hinweis:
Die Kosten für regelmäßige Wartungen und Prüfungen gehören zu den umlagefähigen Nebenkosten. Reparaturkosten hingegen musst du als Vermieter:in selbst tragen.

Führe ein Wartungsbuch, in dem alle Prüfungen, Wartungen und Reparaturen dokumentiert werden. Das hilft bei Streitfällen und ist oft auch gegenüber Behörden verpflichtend.
Moderne Aufzüge müssen mit einer Notrufeinrichtung ausgestattet sein, die rund um die Uhr erreichbar ist.
Die Anforderungen daran sind gesetzlich geregelt:
- Notrufsystem:
Der Aufzug muss eine ständig erreichbare Notrufverbindung zu einer besetzten Stelle bieten (z. B. Notrufzentrale). - Sicherstellung der Betriebsbereitschaft:
Das Notrufsystem muss regelmäßig getestet und gewartet werden.
Umlagefähigkeit:
Die laufenden Kosten für den Betrieb, die Wartung und den Bereitschaftsdienst der Notrufeinrichtung kannst du über die Nebenkostenabrechnung auf die Mieter:innen umlegen.

Achte darauf, dass dein Wartungsvertrag auch die regelmäßige Überprüfung der Notrufanlage einschließt.
Fehlerhafte Notrufsysteme können im Ernstfall schwerwiegende rechtliche Folgen haben.
Wenn der Aufzug ausfällt, kann dies einen erheblichen Mangel der Mietsache darstellen.
Mieter:innen haben dann grundsätzlich das Recht, die Miete zu mindern – abhängig von Dauer und Ausmaß des Defekts.
Wichtige Aspekte:
- Mietminderung ist keine Pflicht:
Mieter:innen müssen eine Minderung nicht automatisch erklären, sondern aktiv geltend machen. - Höhe der Minderung:
Je nach Einzelfall zwischen 3 % und 15 % der Miete – z. B., wenn ein höher gelegener Stock ohne Aufzug schwer erreichbar ist. - Keine Mietminderung bei kurzen Ausfällen:
Kurzfristige Reparaturen (z. B. 1–2 Tage) rechtfertigen meist keine nennenswerte Minderung.

- Lass den Aufzug umgehend reparieren.
- Informiere deine Mieter:innen über die Reparaturmaßnahmen.
- Dokumentiere den Defekt und die Reparatur sorgfältig – so schützt du dich vor unberechtigten Mietminderungen.
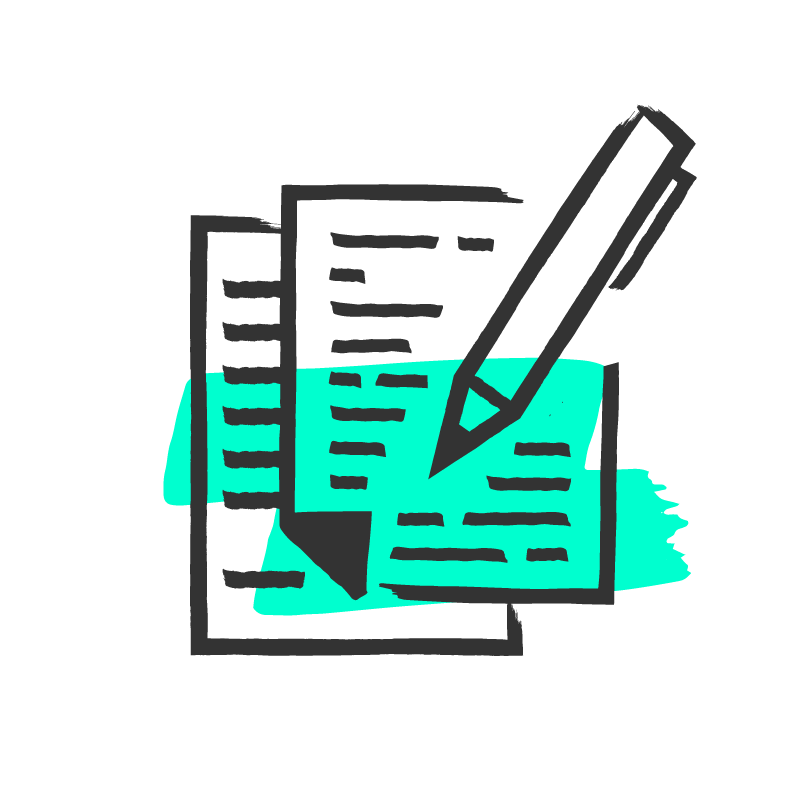
Es ist Zeit für deine Betriebskostenabrechnung?
In nur wenigen Schritten erstellst du deine rechtssichere Betriebskostenabrechnung mit VermietenPlus. Im Anschluss kannst du diese einfach herunterladen oder sie direkt an deine Mieter:innen schicken.
Ein Aufzug ist ein Komfortmerkmal, das den Wert deiner Immobilie steigern und die Vermietbarkeit verbessern kann.
Als Vermieter:in solltest du jedoch genau wissen, welche Kosten du im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf deine Mieter:innen umlegen darfst – und welche nicht.
Regelmäßige Wartung, Betriebsstrom und die Kosten für das Notrufsystem sind umlagefähig und sollten sauber getrennt von Reparatur- oder Modernisierungskosten erfasst werden.
Auch Erdgeschossmieter:innen können rechtmäßig an den Aufzug-Nebenkosten beteiligt werden – vorausgesetzt, dein Mietvertrag enthält eine eindeutige Umlageklausel.
Besonders wichtig:
Behalte den Überblick über Wartungskosten, Notrufe und mögliche Sonderfälle wie gewerbliche Nutzung im Haus. So sicherst du eine rechtssichere und transparente Nebenkostenabrechnung und vermeidest Konflikte mit deinen Mieter:innen.

Plane bei Modernisierungen oder nachträglichem Aufzugeinbau immer auch die späteren Betriebskosten mit ein – und prüfe rechtzeitig, ob du Fördermittel für den Aufzug erhalten kannst.
Informiere dich über weitere Vermieterpflichten in unseren Beitrag Wohnung vermieten: Was müssen private Vermieter beachten?

Du willst keine Neuigkeiten zum Thema Vermietung verpassen?
Ob Immobilien-News, neue Gerichtsurteile oder nützliche Tipps: Mit unserem Newsletter für Vermieter:innen bist du immer auf dem neuesten Stand.
FAQ: Häufige Fragen zu Aufzugskosten
-
Welche Aufzugskosten dürfen auf Mieter umgelegt werden?
-
Umlagefähig sind Wartungskosten, Betriebsstrom, Reinigung und Notrufdienst des Aufzugs. Reparaturen und Modernisierungen dürfen nicht auf Mieter:innen umgelegt werden.
-
Wie hoch sind die Nebenkosten für einen Fahrstuhl in der Betriebskostenabrechnung?
-
Die Nebenkosten für einen Aufzug liegen je nach Nutzung, Wartungsaufwand und Gebäudegröße meist zwischen 500 und 1.500 Euro pro Jahr.
-
Wie werden Aufzugskosten verteilt?
-
In der Regel erfolgt die Umlage der Aufzugskosten auf die Mieter:innen anteilig nach der Wohnfläche. Alternativ kann eine Umlage nach der Personenzahl vereinbart sein, wenn der Mietvertrag dies vorsieht.
-
Müssen Mieter im Erdgeschoss Aufzugskosten zahlen?
-
Ja, auch Erdgeschossmieter:innen müssen Aufzugskosten zahlen, wenn der Aufzug zur allgemeinen Nutzung bereitsteht und eine Umlagevereinbarung im Mietvertrag existiert.
-
Wann dürfen Mieter Belegeinsicht verlangen?
-
Bei Zweifeln an der Nebenkostenabrechnung dürfen Mieter:innen Einsicht in Rechnungen und Wartungsverträge nehmen, um die Aufzugskosten zu überprüfen.

Nadine Kunert informiert dich als Immobilienexpertin und Redakteurin von ImmoScout24 mit informativen und sorgfältig recherchierten Inhalten rund um das Thema Immobilienverkauf und Vermietung. Nadine ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, hat viele Jahre als Content Managerin in der Baubranche gearbeitet und ist seit 10 Jahren selbst Vermieterin. Dadurch hat sie einen praxisnahen Bezug und strebt danach, die Themen leserfreundlich und verständlich für dich aufzubereiten.
Die ImmoScout24 Redaktion verfasst jeden Beitrag nach strengen Qualitätsrichtlinien und bezieht sich dabei auf seriöse Quellen und Gesetzestexte. Unsere Redakteur:innen haben ein hohes Niveau an Immobilienwissen und informieren Sie als Expert:innen mit informativen und vertrauenswürdigen Inhalten. Wir verbessern und optimieren unsere Inhalte kontinuierlich und versuchen, sie so leserfreundlich und verständnisvoll wie möglich aufzubereiten. Unser Anliegen ist es dabei, Ihnen eine erste Orientierung zu bieten. Für persönliche Anfragen Ihrer rechtlichen oder finanziellen Anliegen empfehlen wir Ihnen, eine:n Rechts-, Steuer-, oder Finanzberater:in hinzuzuziehen.
 Ähnliche Artikel
Ähnliche Artikel
